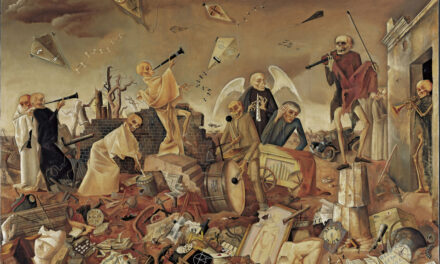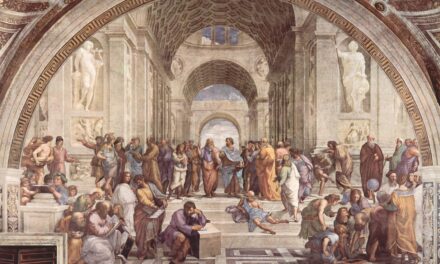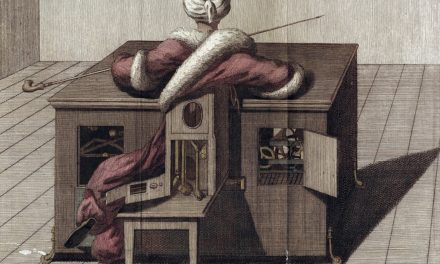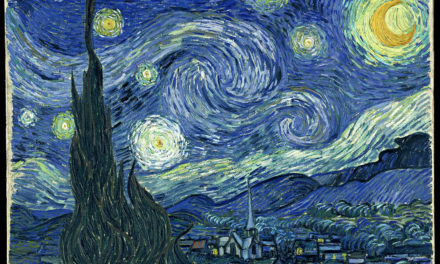Wir haben die Kunst voll im Griff

Ein österreichisches Museum, welches sich mit der Geschichte des Militärs und Heeres auseinandersetzt, wirbt mit dem Slogan: „Kriege gehören ins Museum!“ – und dort sollten sie auch alle sein. Waffen und reale Gewalt sind Vernichter von Kunst und Kultur und deshalb sind sie für unseren Blog ohne Bedeutung. Jedoch bei einem Rundgang durch die Wiener „Hofjagd- und Rüstkammer“ drängte sich mir der Teil eines Objektes so lange auf, bis er, letztendlich, zu diesem Beitrag führte: Die Griffe von Schwertern, Degen und Säbeln.
- Prunkschwert Friedrich III. um 1450, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Zeremonienschwert Sigismund I. um 1433, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Erfreulich ist, für denjenigen dem Kultur am Herzen liegt, dass diese Art von Hieb- und Stichwaffen, bei heutigen kriegerischen Auseinandersetzungen, keine Rolle mehr spielen und wirklich im Museum gelandet sind.
- Einhandschwert (Ochsenzunge) um 1565, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- St Peters Ritterschaft, Maximilian I. 1509, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Die ältesten erhaltenen Schwerter datieren in die Mitte des 4. Jahrtausend vor Christus, also aus der Bronzezeit, und wurden in der Türkei gefunden. Die Hauptmerkmale von Klingen haben sich, über tausende von Jahren hinweg, nicht wesentlich verändert, denn das Wichtigste war immer, dass die Form der Funktion folgt. Künstlerische Freiheiten, abgesehen von Inschriften, waren somit begrenzt. Wenige Sonderformen existierten, diese variierten im Zweck der Waffe.
- „Ainkhürn“-Schwert, Karl der Kühne, Burgund, Mitte 15. Jhdt., KHM Verband, Schatzkammer Wien
- Prunkschwert Maximilian I., 1494, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Ganz anders sah es bei den Griffen dieser Waffen aus, obwohl diese ebenfalls immer dem Notwendigen folgten. Die „Parierstange“, der metallene Stab zwischen Hand und Klinge, schützte die Hand vor der eigenen und fremden Klinge. Das „Heft“ war der eigentliche Griff der Waffe. Den „Knauf“ bildete die Kugel am Ende des Schwertes, sollte das Abrutschen der Hand verhindern und diente zur richtigen Gewichtverteilung und Balance gegenüber der Klinge.
- Schwert mit Kalenderklinge 1533, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Kaiser Karl V. um 1600, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Verbunden waren Griff und Klinge meist durch einen „Erl“. Er war eine schmälere Verlängerung der Klinge, die im Griff mündet und mit diesem fixiert wurde. Sehr gebräuchlich war auch die Version, die den „Erl“ durch den gesamten Griff führte und ihn mit dem Knauf verschraubte oder vernietete.
- Prunksäbel Maximilian II. Mitte 16. Jhdt. KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Korallensäbel, Erzherzog Ferdinand II. um 1560, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Durchschnittliche Schwerter, oder auch in Kriegszeiten hergestellte Massenware, hatten meist Griffschalen aus Holz, die mit Leder überzogen oder mit Draht umwickelt waren. Bei der Führung der Waffe konnte ein sicherer „Grip“ entscheidend sein.
- Jagdschwert, Erzherzog Ferdinand II. von Innerösterreich, 1633, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Zeremonienschwert um 1560, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Die fortschreitenden technischen Entwicklungen veränderten auch die Waffen. Einer Plattenpanzerung konnte ein Schwert nicht sehr viel anhaben und so entwickelten sich die Hiebwaffen zu Stichwaffen, deren Ziel es war zwischen die Platten zu dringen. Damit einhergehend entstanden Rapier und Degen.
- Goldener Degen, Maximilian II. um 1550, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Orientalischer Säbel, Ende 17. Jhdt. KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Diese Stichwaffen wurden wesentlich leichter in Gewicht und Bedienung, und natürlich auch eleganter. Aber auch der Schutz der Hand fand neue Wege, in Kreuzgefäßen und Körben mit mehrfachen Haupt- und Nebenbügeln. Die neuere, leichtere und elegantere Handhabung verlangte einen besseren Schutz der Finger.
- Persischer Säbel, Schah von Persien 1813, Foto: Kultur Jack
- Indischer Säbel 17.Jhdt. KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Knauf, Heft und Parierstange wurden zusammenfassend als „Gefäß“ bezeichnet, und solange dieses seinen schützenden Zweck erfüllte, war der künstlerischen Freiheit keine Grenzen gesetzt. Aus Kostengründen wurde bei Massenware für dem Kampf nur auf Funktionalität Wert gelegt. Deshalb haben die hier gezeigten Waffen vermutlich nie kriegerische Kampfhandlungen erlebt.
- Handschar Kaiser Ferdinand I. 1841, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Türkischer Säbel, 17.Jhdt. KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Mit der Erfindung des Schießpulvers hatten Hieb- und Stichwaffen im Krieg überwiegend ausgedient, jedoch als Rangwaffe für Offiziere und Kavalleristen blieben sie erhalten. Ein Kuriosum war der Trauerdegen, den man für Trauerfälle bei Hofe trug. Er, war schlichter gehalten, das Eisen kaum reflektierend, der Griff mit schwarzem Krepp umwickelt und die Scheide aus schwarzem Leder.
- Hofdegen Meissner Porzellan 18.Jhdt. KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Hofdegen Sevres Porzellan 1740, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Galanterie- und Beamtendegen schmückten die Erscheinung des Hofadels, von Diplomaten und Beamten, und mit der Zeit trug ihn die gebildete Oberschicht als zierendes Beiwerk. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Degen eine beliebte Waffe bei Duellen.
- Kurzer Hofdegen, Bergkristall 1649, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Hofdegen Bernstein 1650, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Am Anfang des 20. Jahrhunderts schmückte der Degen, noch immer, die Ausgangsuniformen von Offizieren. In den USA und Großbritannien ist diese Waffe bis heute ein Teil einiger Paradeuniformen.
In der Gegenwart findet der Degen als Sportwaffe Verwendung, aber auch bei Mensuren von Studentenverbindungen. Die Mensur ist weder Sport noch Duell, sondern, da es auf Freiwilligkeit beruht und bestimmte Sicherheitsvorrichtungen eingehalten werden, rechtlich ungefähr dem Boxen gleichgestellt.
- Rapier, blauer türkisfärbiger Glaspasta, Erzherzog Sigmund um 1650, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
- Kurzer Hofdegen, Gold mit Email und Onyx, 1664, KHM Verband, Weltmuseum, Hofjagd- und Rüstkammer Wien
Liebe Leute, es ist schon ein wenig verwunderlich, dass man ein Objekt, das dem Tod und der Vernichtung dient, künstlerisch gestalten ließ und der Betrachter geschaute Schönheit empfindet.
Euer, Kultur Jack!
Beitragsbild: Diamantsäbel (Detail), KHM Verband, Weltliche Schatzkammer Wien